

In der Sächsische Zeitung, Samstag,
18. Juni 2005 und weitere Ausgaben wurden 17 Bauden im Riesengebirge vorgestellt.
Herr Karl-Heinz Drescher aus Leipzig hat dazu eine Kommentierung für die "Bergwacht"
geschrieben, die hier mit seiner freundlichen Genehmigung veröffentlicht wird.
Er stellte auch aus seiner privaten Sammlung die abgebildeten Ansichtskarten
zur Verfügung.
Unter dem Titel "Zu Besuch in
den Bergbauden des Iser- und Riesengebirges" stellte die Sächsische Zeitung
im Internet unter www.sz-online.de (ABO
erforderlich) im Zeitraum vom Juni bis Oktober 2005 siebzehn Bauden beiderseits
der Grenze vor.
Während Eva Jeschkova die Bauden auf böhmischer/tschechischer Seite vorstellt,
hat die gleiche Aufgabe Hans Schulz auf schlesischer/polnischer Seite übernommen.
Die Beiträge sind weder alphabetisch noch geographisch geordnet, sondern erscheinen
in loser Folge. Prioritäten der Bauden wurden nicht gesetzt, denn die ältesten
und bedeutendsten Bauden des Riesengebirges, die Wiesenbaude/Lucni bouda- und
die Hampelbaude/Schronisko "Strzecha Akademicka", werden nicht vorgestellt.
Das Interessante dieser Beiträge, besonders für die vertriebenen Bewohner
des Riesen- und Isergebirges, dürfte nicht die Vorstellung der Bauden schlecht
hin, ihr Standort und ihre Umgebung sein, denn das ist den meisten Lesern noch
hinreichend bekannt und in lieber Erinnerung.
Interessant dürften die heutigen Eigentumsverhältnisse, ihre neuen Besitzer
bzw. Betreiber sein. Noch wichtiger, man lässt sie zu Wort kommen. Sie sprechen
nicht nur über das Tagesgeschäft, über Erfreuliches, Sorgen und Nöte, sie geben
auch Auskunft über die Perspektiven des Tourismus im Gebirge allgemein und die
damit verbundenen Zukunftsaussichten der Bauden. Die Historie kommt auch nicht
zu kurz, wobei manches schlecht recherchiert, falsch und daher berichtet werden
muss. Ansonsten eine Einladung ins Riesengebirge der etwas anderen Art.
Wer aber unser Riesengebirge kennen lernen will muss es erwandern, "O Täler
weit, O Höhen" – was die Kammwanderung von Oberschreiberhau bis zu
den Grenzbauden dem Auge des Wanderers bietet, war und ist in keinem anderen
deutschen Gebirge zu finden.
Daher möchte ich für den interessierten Leser der Bergwacht die Vorstellung
der Bauden mit dieser Wanderung verbinden.
Unsere Wanderung beginnt in Schreiberhau bei der Josephinenhütte, die heute
stillgelegt ist und führt in 40 Minuten zum Zackelfall. Oberhalb des Falles
überschreitet der Weg bei der Schleuse den Bach und durch den Wald, mäßig ansteigend,
vorbei an einem Felsen "Rübezahls Würfel", kommt man nun steil ansteigend
am Ende der Baumregion, nach vielleicht 1,5 Std. zu unserer ersten Station,
der Neuen Schlesischen Baude / p. Schronisko "Na Hali Szrenickiej".
|
|
|

|

|
|
|
|
Unter der Überschrift "Wo sich im Winter die Skiläufer tummeln",
schreibt Hans Schulz u.a. folgendes:
Das Gebäude hieß zu damaliger Zeit "Kranichbaude", später "Neue
Schlesische Baude". Jener Name galt bis 1945. Zunächst war die Bedienung
von Touristen für die Baudenbewohner nur eine Nebenbeschäftigung. 1846 entstand
jedoch ein zweites Gebäude, die Sommerbaude, das als Berghütte für Wanderer
diente. 1937 erhielt die Baude die heutige Gestalt, den jetzigen Namen 1950,
nachdem der Polnische Verband für Touristik und Landeskunde entstanden war.
Seit der Renovierung 1961/1962 ist sie die größte Baude auf der schlesischen
Seite des Riesengebirges. Jan Zielinski ist seit 1992der Leiter. Touristen können
in Doppel-, Dreibett- und Vierbettzimmern übernachten. Anspruchsvollen Gästen
stehen Appartements mit Dusche, WC und Fernseher zur Verfügung. Preiswerter
sind Übernachtungen in Schlafräumen für sechs, acht, zehn und zwölf Personen.
Außerdem bietet die Baude Vollverpflegung an. Im Winter tummeln sich vor der
Baude Abfahrtsläufer, denn die Kranich- oder auch Grenzwiese ist Teil des Ski-
Gebietes "Ski Arena Szrenica".
Für Freunde des Riesengebirges, die etwas mehr über die Geschichte der Baude
erfahren möchten, wäre noch in Kurzform hinzuzufügen, dass alles mit einer Viehbaude
anfing. Schwiegersöhne des verstorbenen Baudenmannes Franz Hallmann bezogen
die Baude. Einer von ihnen, Wenzel Krause aus den Krausebauden, wird 1787 im
Schreiberhauer Kirchenbuch als Pächter der "Neuen Baude" bezeichnet.
Später übernimmt er die "Böhmische Grenzbaude", die spätere Wosseckerbaude
(1790). Ein weiterer Schwiegersohn, diesmal aus der Alten Baude, Johann Paul
Adolph übernimmt dann die Baude. Von ihm stammen die Adolphs, die bis 1945 die
Baude bewirtschaftet haben. Aus bescheidenen Anfängen heraus wurde 1869 mit
dem Bau des Weges von Schreiberhau (Zackenfall), aus der Viehbaude ein besuchtes
Berggasthaus. 1875 gab es schon echtes Bier aus Bayern. 1909 übernimmt Heinrich
Adolph die Baude. In dessen Zeit fällt der Umbau durch die Architekten Gebrüder
Albert, die auch später die Reifträgerbaude erbauten, zum modernen Berghotel.
30 Zimmer mit 80 Betten waren im Angebot. Neben der Baude befand sich noch ein
Badeteich für die Gäste. Das Wasser wurde auch zum Antrieb einer Turbine genutzt,
denn die Baude erzeugte ihre Elektrizität selbst.
Heinrich war ein echter Wintersportler. Er war nicht nur der Gründer des ersten
Schneeschuhvereins, er trug auch den Ruhm des winterlichen Gebirges in die Welt
hinaus. Nach seinem Tod wurde ihm zu Ehren der Heinrich-Adolph-Gedächtnislauf
alljährlich zu Ostern ausgetragen.
Nach 1945 hat es auch hier und zwar im Dachstuhl gebrannt, so das heute im Mitteltrakt
ein Stockwerk fehlt.
Wir setzen unseren Weg fort und kommen in die Knieholzzone. Nach wenigen Minuten
gehen wir nach links auf dem Seydelweg in Richtung Pferdekopfsteine und gelangen
zu unserem nächsten Ziel, der Reifträgerbaude / p. Schronisko "Szrenca".
|
|
|
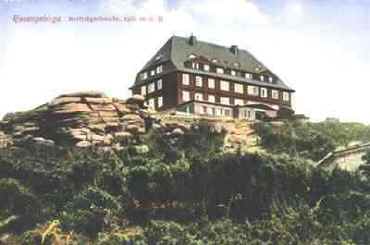
|

|
|
|
|
Unter der Überschrift "Wo
es den schönsten Rundblick ins Gebirge gibt", kann man folgendes lesen:
Die auf dem höchsten Gipfel stehende Reifträgerbaude auf schlesischer Seite
wurde als "Trotzhaus" errichtet. Der deutsche Pächter Endler stritt
mit der Verwaltung der Herrschaft Starkenbach (Jilemnice) um den neuen Pachtvertrag
über die Wosseckerbaude (Vosecka bouda). Er war bestrebt die Pacht zu erneuern,
aber seine Bemühungen blieben erfolglos. Die Baude nahm der tschechische Legionär
Hercik in Pacht. Von den deutschen Bewohnern wurde Geld für eine neue Baude
gesammelt. Nach Plänen der Gebrüder Albert entstand 1921/1922 in wenigen Wochen
in unmittelbarer Nähe auf dem Gipfelgrat des Reifträgers eine neue, große, speziell
für den Wintersport bestimmte Herberge, die nach dem Willen ihrer Gründer den
Namen Deutsch-Böhmerhaus erhielt, aber im Volksmund Reifträgerbaude genannt
wurde. Sie war vor allem wegen ihrer gemütlichen Atmosphäre bekannt. Von hier
aus hat man den schönsten Rundblick im westlichen Riesengebirge, in das Hirschberger
Tal und auf das Iser- sowie Lausitzer Gebirge.
1968 fiel das Gebäude einem Brand zum Opfer, wurde jedoch wieder hergestellt.
Und 1992 als privat bewirtschaftete Baude von Ewa und Wojciech Klopotowscy wieder
eröffnet. Sie steht Touristen auch zur Übernachtung zur Verfügung. Gäste loben
insbesondere die Hausmannskost. Erfreulich, dass der gebirgstypische Charakter
einer Berghütte erhalten geblieben ist. Soweit Hans Schulz.
Unter www.szrenica.pl
teilen die Wirtsleute in Polnisch, Deutsch und Englisch mit, das die Baude,
als einzige Baude im Riesengebirge eine Kategorie besitzt. Sie bieten 90 Betten
an. Der Preis im Doppelzimmer pro Person beträgt ca. 9,00 Euro. Ein Zweizimmer-Appartement
kostet 45,00 Euro. Die Preise für Speisen betragen zwischen 1,00 und 5,00 Euro.
Spezialitäten sind Eierkuchen mit Quark und Heidelbeeren mit Sahne.
Auch hier einige Korrekturen:
Die Baudengründung ist nicht mit einem fehlenden Pachtvertrag zwischen Endler
und der Herrschaft Starkenbach allein zu erklären. Hier macht es sich Hans Schulz
sehr einfach. Für die Vertreibung von Endler aus Tschechien und der Neugründung
gab es handfeste politische Gründe. Mit dem Zusammenbruch der österreichischen
Monarchie bildete sich die Tschechoslowakische Republik. Eine ihrer ersten Entscheidungen
war die Durchführung einer Bodenreform, die vor allem den Großgrundbesitz im
Grenzgebiet betraf. Da Franz Endler keinen gültigen Kaufvertrag hatte, wurde
von staatlicher Seite alles unternommen, um ihn letztendlich zu vertreiben und
einen Tschechen als Verwalter einzusetzen. Im Grunde ging es letztlich um die
Tschechisierung in dem vorwiegend von Deutschen bewohntem Gebiet. Die Herrschaft
Starkenbach spielte am Ende nur eine untergeordnete Rolle. Vater Franz Endler
erlebte den Aufstieg der Baude nicht mehr. Er hat die Vertreibung aus der Wosseckerbaude
nie überwunden. Einer seiner Söhne, Kurt Endler, wurde einer der erfolgreichsten
deutschen Wintersportler und hat durch seine Siege das winterliche Riesengebirge
in der Welt bekannt gemacht.
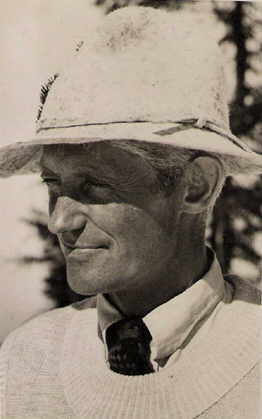
Wir verlassen den Reifträger und erreichen
an den Sausteinen wieder den Kammweg. Auf ebenen Weg geht es weiter bis zu den
Quargsteinen. Danach, am Grenzstein Nr. 123, biegen wir rechter Hand ab und
erreichen nach wenigen Minuten die Wosseckerbaude / Vosecka bouda.
|
|
|
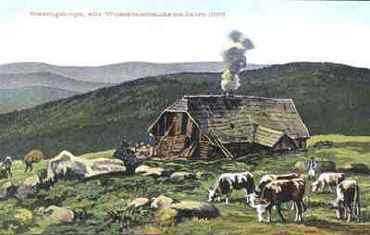
|

|
|
|
|
Unter der Überschrift, "Wo abends um zehn das Licht aus geht",
kann uns Eva Jeschkova u.a. folgendes mitteilen:
Die Baude ist nicht nur eine bekannte Herberge im Riesengebirge, sondern auch
ein beliebtes Ausflugsziel
Gegründet wurde sie schon Mitte des 18. Jahrhundert als Unterschlupf für Holzarbeiter.
Sie wurde auch "Neue Tschechische" oder "Frantiskanska Baude"
genannt. Zur Herberge wurde sie im Jahre 1896 und 1900 als Besitz des Fürsten
Jan Harrach erweitert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie rekonstruiert und
erneut erweitert. Heute gehört die Baude dem Klub tschechischer Touristen. An
dem Haus beginnt der Weg der tschechisch-polnischen Freundschaft, der den Gebirgsrücken
zu beiden Seiten der Grenze verfolgt.
"Hier gibt es offensichtlich das teuerste Bier und Essen im ganzen Riesengebirge",
sagt der müde Tourist Jiri Slocar aus Liberec (Reichenberg), "aber was
lässt sich machen, wenn man von einem mehr als zweistündigen Anstieg aus Harrachov
kommt". Für einen halben Liter Bier zahlt man hier oben 39 Kronen (1,30
Euro). "Wir sind teuer, das stimmt, aber nicht, weil wir die Einkehrenden
übers Ohr hauen wollen", sagt der Leiter der Baude, Petr Hronvsky. "Die
Baude ist schwer erreichbar, und die Lebensmittel hier herauf zu schaffen, kostet
sehr viel Geld". Auf der Wossecker Baude muss sogar der Strom mit einem
Dieselaggregat hergestellt werden. Nach 10 Uhr abends wird ausgeschaltet. Danach
leuchtet nur noch im Erdgeschoss ein Notlicht, in den Stockwerken und auf Zimmern
ist es dunkel. Eben eine echte Gebirgsbaude. Die Touristen stört das nicht,
die wollen sich hauptsächlich ausruhen. Die Baude hat 46 Unterkunftsplätze in
Zwei- und Dreibettzimmern. Die Übernachtung kostet 230 Kronen (acht Euro). Viele
Stimmen sind kritisch. Sie klagen nicht nur über die Preise, sondern auch über
unfreundliches Personal. Dafür schmeckt das Essen: Die Spezialität ist russischer
Bortsch für 68 Kronen (zwei Euro).
Zu ergänzen wäre, das der Name Wossek- Wasserecke von den sumpfigen Kranichwiesen
abgeleitet wurde. Baudenleute aus den Krausebauden weideten hier im Sommer ihre
Tiere. Wenzel Krause, den wir bereits von der Neuen Schlesischen Baude her kennen,
erwirkte 1790 von der Herrschaft Starkenbach die Genehmigung zum Bau einer Sommerbaude,
die den Namen Neue Böhmische Baude erhielt bzw. in Anlehnung, das sich ein Mönch
dort aufgehalten hat, auch "Franziskaner Baude" hieß.
Eva Jeschkova irrt, wenn sie von der "Neuen Tschechischen" oder "Frantiskanska
Baude" spricht. 1790 hieß dieser Landesteil Böhmen, gehörte zu Österreich
und wurde fast ausschließlich von deutschsprachigen Menschen bewohnt. Wie sollten
sie auf die Idee kommen, die Baude als "tschechisch" zu bezeichnen,
das hatte damals nichts mit Vorurteilen oder Rassismus zu tun.
Es ist jetzt leider üblich, das man im Nachbarland das Wort "Böhmisch"
durch das Wort "Tschechisch" ersetzt. Es ist nur schwer zu verstehen,
das z.B. auch im Falle der Böhmischen Baude auf der Schneekoppe, welche 1868
von Blaschke aus den Grenzbauden erbaut wurde und bis 1945 unter diesen Namen
bekannt war und auch in die Literatur eingegangen ist, plötzlich Tschechische
Baude heißen soll. Es handelt sich wohl dabei um einen etwas übertriebenen Nationalismus.